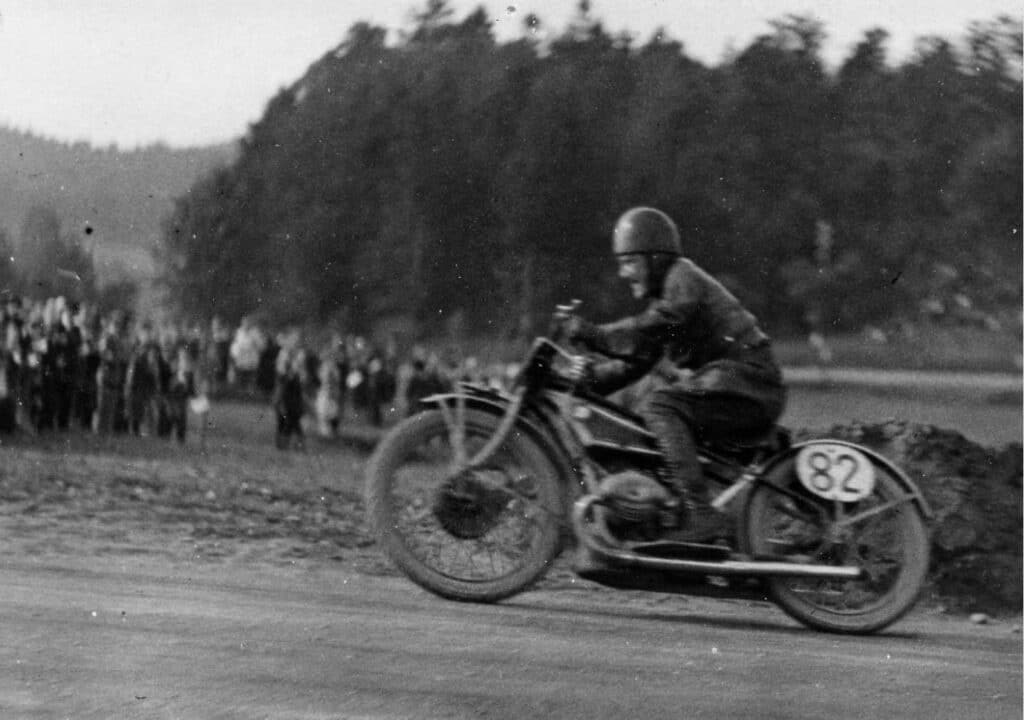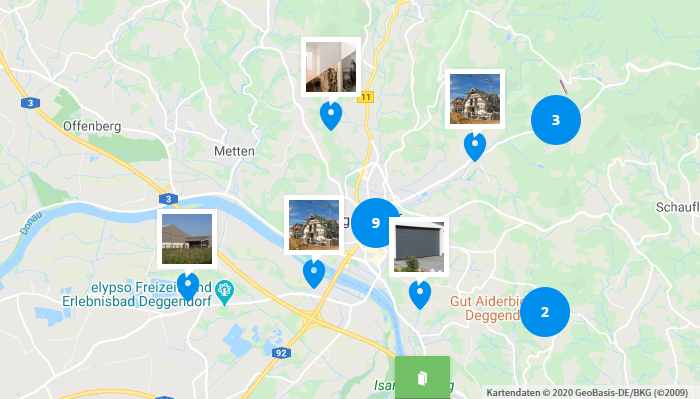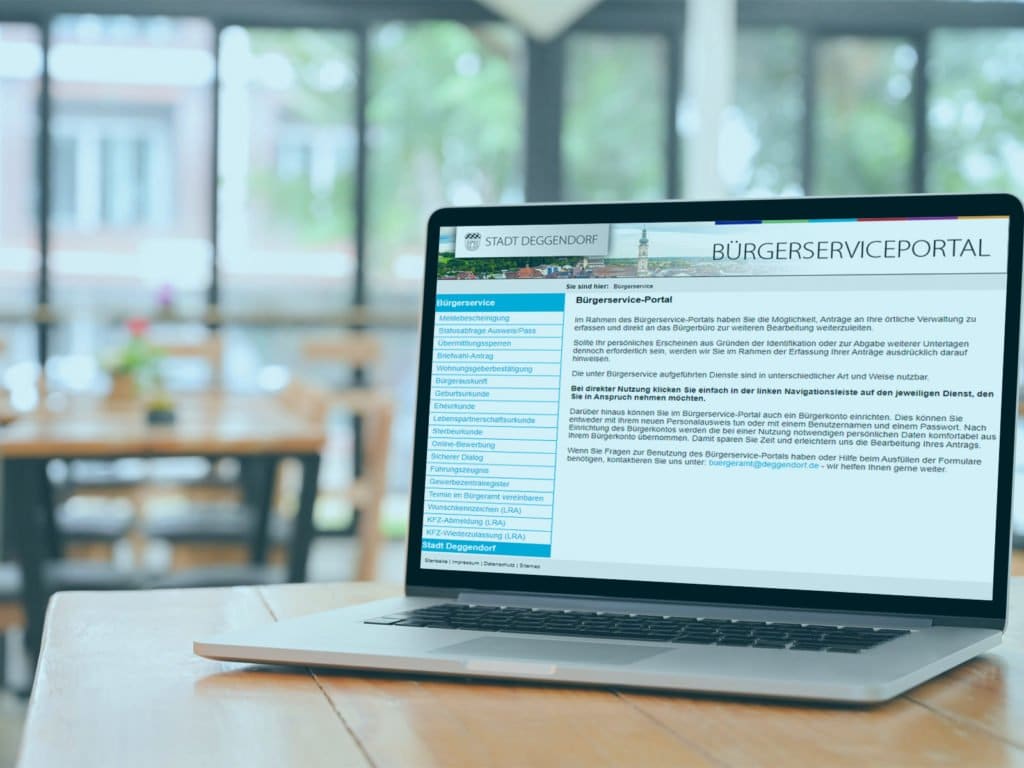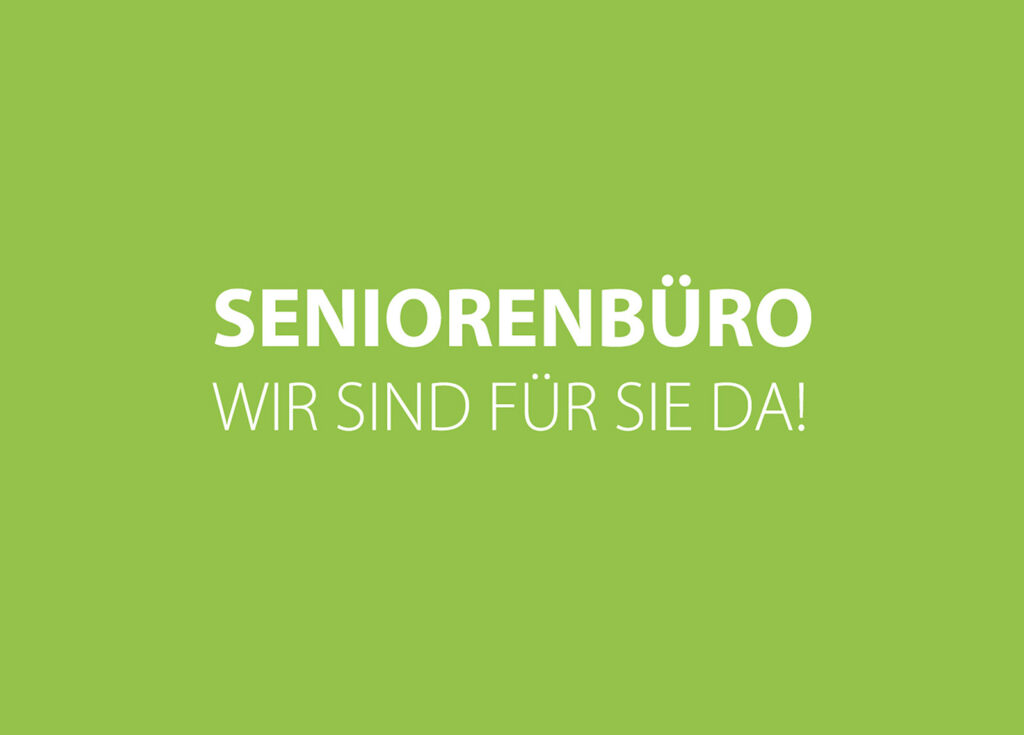Stadt Deggendorf
Neues Rathaus
Mo. 07:30 – 12:00 & 13:00 – 16:00
Di. 08:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00
Mi. 08:00 – 12:00
Do. 08:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00
Fr. 08:00 – 12:00
Kontakt
+49 991 2960 0
+49 991 2960 199
Zur Vermeidung von Wartezeiten im Bürgeramt & Standesamt empfehlen wir eine vorherige online Terminreservierung